Du arbeitest im Gesundheitswesen - was kannst DU gegen Medical Gaslighting tun?
Dieser Abschnitt soll einige Ansätze bieten, wie du als medizinisches Fachpersonal mit kleinen Veränderungen einen sensiblen Umgang mit deinen Patient*innen umsetzen kannst. Als Person, die im Gesundheitswesen tätig ist, trägst du eine individuelle Verantwortung und kannst im täglichen Kontakt mit Patient*innen durch Empathie und Bewusstsein über strukturelle Probleme viel bewirken.
Die Empfehlungen und Hinweise sollen dazu beitragen, eine gerechtere und diskriminierungsärmere medizinische Versorgung zu fördern. Besuche gerne die Plattformen der aufgezählten Organisationen und Menschen für weitere Informationen und Materialien. Tausche dich aus und spreche mit anderen Mitarbeitenden im Gesundheitssystem.
Wenn du eigene Hinweise für weitere Informationen oder Ergänzungen zu unseren Quellen hast, freuen wir uns über deinen Input.
Welchen Einfluss hat ein sensibilisierter Umgang auf die Behandlungsqualität?
Ein einfühlsamer, respektvoller Umgang schafft die Grundlage für eine vertrauensvolle Ärzt*innen-Patient*innen-Beziehung. Besonders bei komplexen oder langwierigen Beschwerden kann dies entscheidend sein, um gemeinsam tragfähige Entscheidungen zu treffen (Shared Decision-Making) und den Behandlungserfolg zu unterstützen.
Studien zeigen, dass eine gute Beziehungsebene zwischen medizinischem Fachpersonal und Patient*innen sowohl die Therapietreue als auch den langfristigen Gesundheitsverlauf positiv beeinflussen kann (4).
Warum profitierst auch du von einem sensibilisierten Umgang?
Ein respektvoller Umgang fördert das Vertrauen zwischen deinen Patient*innen, anderen Ärzt*innen, Therapeut*innen und Dir. Dadurch fühlen sich deine Patient*innen ernst genommen und sind eher bereit, ihre Bedenken mitzuteilen. Dies ermöglicht dir, wichtige Informationen zu erfahren, um wiederum schneller und besser eine präzisere Diagnose stellen zu können. So kannst du eine adäquatere Behandlung leisten. Du kannst Fehldiagnosen und -behandlungen reduzieren. Das entlastet dich und dein Umfeld ((3), (4)).
Welche Ansätze gibt es für einen sensibilisierten Umgang?
Warum ist eine passende Kommunikation wichtig und wie kann sie umgesetzt werden?
Als medizinisches Personal hast du sehr häufig direkten Kontakt zu Patient*innen. Dabei kann die passende Kommunikation entscheidend sein, für die korrekte Ausführung des medizinischen Berufes. Es beginnt mit der Anrede, die oft nur zwei Geschlechter umfasst: Mann und Frau. Für viele Patient*innen ist das auch passend. Allerdings ist wissenschaftlich belegt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt (1). Diese werden mit den zwei gängigen Anreden nicht richtig angesprochen. Als medizinisches Personal ist es aber sehr wichtig, die Patient*innen wirklich zu sehen.
Lösungsideen:
Frage direkt bei Anmeldung oder Terminvereinbarung nach der gewünschten Ansprache und notiere sie im System. Wenn du Menschen aufrufen möchtest, kannst du auch nur den Nachnamen sagen ohne Anrede, oder damit es etwas persönlicher ist, Vor- und Nachnamen.
Dasselbe gilt für die Sprache, in welcher kommuniziert wird. Sprechen Patient*innen mehrere Sprachen, kann das Abfragen der Erst- und Zweitsprache helfen. Womöglich fühlen sie sich mit einer anderen Sprache wohler, das kann die Behandlung erleichtern. Das ist natürlich nur möglich, wenn du selbst auch diese Sprache sprichst oder einen (elektronischen) Übersetzungsdienst als Unterstützung hast. Es gibt angepasste Anamnesebögen für Allgemeinmedizin, Gynäkologie und Psychotherapie (VT) (3).
Empathie ist kein Zusatz, sondern Teil klinischer Qualität. Sie schafft Vertrauen, fördert Offenheit und kann, z. B. durch das gezielte Hineinversetzen in die Perspektive der Patient*innen diagnostische Prozesse deutlich verbessern (3) . Ziel ist nicht emotionale Nähe, sondern ein aufmerksames Gegenüber: Präsenz im Gespräch, aktives Zuhören, ernst nehmen, was gesagt wird – auch zwischen den Zeilen.
Den Blickkontakt zu halten und eine kurze, authentische Rückmeldung (beispielsweise "Das klingt belastend") reicht oft, um Haltung zu zeigen. Personen zu validieren, ihnen dein Verständnis zu spiegeln (beispielsweise „Das kann ich gut nachvollziehen“) fördern das Vertrauen. Geduld ist dabei entscheidend – auch in stressigen Momenten solltest du ruhig und freundlich bleiben.
Auch deine Körpersprache spielt eine große Rolle: Eine offene Haltung, ein zugewandter Blick und ein ruhiger Ton vermitteln Verständnis. Wichtig ist hierbei, verständlich zu sprechen – ohne unnötigen Fachjargon. Ermögliche außerdem Raum für Rückfragen und versuche Zeit einzuräumen, neue Informationen zu verarbeiten. Auch nonverbale Signale, wie beispielsweise ein zustimmendes Nicken zeigen: “Ich sehe dich, ich höre dir zu, und ich nehme dich ernst.” (3)
Wie gelingt eine genderinklusive Sprache ?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um alle Personen, neben dem weiblichen und dem männlichen Geschlecht, einzubinden. Du kannst die Doppelnennung nutzen: also von Patientinnen und Patienten reden, oder das Gendersternchen/den Doppelpunkt nutzen: also Besucher - Pause - innen, geschrieben als Besucher*innen. Diese Variante nennt sich Glottisschlag und ist in der deutschen Sprache weit verbreitet. Ein Beispiel: Spiegelei (Spiegel - Pause - Ei). Gendern funktioniert genauso :). Oder du nutzt genderneutrale Sprache ohne Sonderzeichen, zum Beispiel sprichst du dann von Erkrankten oder Therapierenden (3).
Wie kannst du die körperliche Untersuchung angenehmer gestalten?
Für viele Menschen ist körperlicher Kontakt mit fremden Personen – auch Fachpersonal – unangenehm. Manche Patient*innen reagieren sensibel auf Berührungen, etwa aufgrund negativer Erfahrungen im Gesundheitswesen oder (sexualisierter) Gewalt.
Informiere deine Patient*innen über körperliche Berührungen im Rahmen der Untersuchung.
Hole dir zu Beginn Einverständnis (Consent) ein.
Erkläre die nachfolgenden Schritte und begründe, warum du sie durchführst.
Damit du deinen Patient*innen langfristig helfen kannst, müssen sie verstehen, was bei Diagnostikverfahren und Therapien mit ihren Körpern passiert und welche Konsequenzen das haben kann. Manche Untersuchungen könnten auch von den Patient*innen selbst durchgeführt werden unter deiner Anleitung (bspw. in der Gynäkologie das Abtasten der Brust, Auftragen von Gel vor vaginaler Untersuchung). (3)
Warum ist neben einer fachlichen Weiterbildung auch eine stetige Selbstreflexion essentiell, um eine gute Gesundheitsversorgung zu leisten?
Die Medizin und die Psychotherapie werden immer noch von veralteten Mustern beherrscht, die eine Großzahl von Menschen kategorisch ausschließt.
Die Berufsethik verpflichtet das Personal im Gesundheitswesen zu kontinuierlichen Fortbildungen. Dazu gehört zum Beispiel das Erkennen und Vermeiden von Mikro- und Makroaggressionen.
-
Mikroaggressionen sind alltägliche, scheinbar unbedeutende Äußerungen, Fragen oder Gesten, die eine Person oder eine Gruppe aufgrund ihrer Herkunft, Religion, Hautfarbe, sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechts diskriminieren und verletzen können. (Bsp.: “Wo kommst du eigentlich her?” “Alle Frauen wollen Kinder.” “Machen Sie einfach mehr Sport.”) Das passiert oft unbewusst. Der Schaden für betroffene Personen ist aber groß. Diese Aussagen können bereits eine Form von Medical Gaslighting sein. Solche Mikroaggressionen resultieren aus diskriminierenden Vorurteilen und müssen deshalb hinterfragt werden.
-
Makroaggressionen sind offene und bewusste Formen von Diskriminierung und Gewalt. Sie können sowohl auf individueller als auch auf struktureller Ebene auftreten. Es können z.B. rassistische oder homophobe Beleidigungen sein oder körperliche Angriffe. Du kannst dich informieren, welche Aussagen dazu gehören und wie du vermeiden kannst, deine Patient*innen zu verletzen (3).
Stell dir auch diese Fragen:
“Fehlt es vielleicht an regelmäßigen Fortbildungen?”
“Welche Themen werden nicht abgebildet?”
Kenne die Rechte der Patient*innen!
Um sowohl deine Patient*innen, aber auch dich selbst zu schützen, solltest du die Rechte dieser kennen. Genauso wichtig ist es, über deine Pflichten als medizinisches Fachpersonal informiert zu sein. (3)
Eigene Vorurteile erkennen und abbauen:
Vorurteile sind Teil unseres Denkens – auch im medizinischen Alltag. Oft entstehen sie unbewusst durch Erfahrungen, gesellschaftliche Rollenbilder oder auch durch das, was wir in der Ausbildung lernen (2). Vor allem im medizinischen Setting werden Schubladen genutzt, um Beschwerden einzuordnen und Diagnosen zu finden. Diese Denkmuster können in Notsituationen teilweise hilfreich sein, doch gleichzeitig können sie auch dazu führen, dass Symptome bestimmter Personengruppen nicht richtig eingeordnet und Menschen falsch behandelt werden.
Der erste Schritt ist, diese Vorurteile überhaupt zu erkennen.
Frag dich:
“Beurteile ich Patient*innen unterschiedlich, je nachdem, ob sie FLINTA* oder cis-männlich sind?”
“Habe ich schon einmal eine Diagnose zu schnell festgelegt, ohne genau hinzuhören?”
Es kann helfen, sich im Team auszutauschen und ehrlich in die Selbstreflexion zu gehen. Denkfallen passieren schnell und müssen enttarnt werden. Vorurteile abzubauen, heißt bewusst innezuhalten, zuzuhören und jede Person individuell wahrzunehmen. Nimm dir Zeit, auch wenn der Alltag stressig ist, und hinterfrage deine ersten Eindrücke. Nutze Checklisten oder Leitfäden, um Diagnosen systematisch und ohne voreilige Schlüsse zu prüfen.
Das wünschen sich Patient*innen von Ärzt*innen:





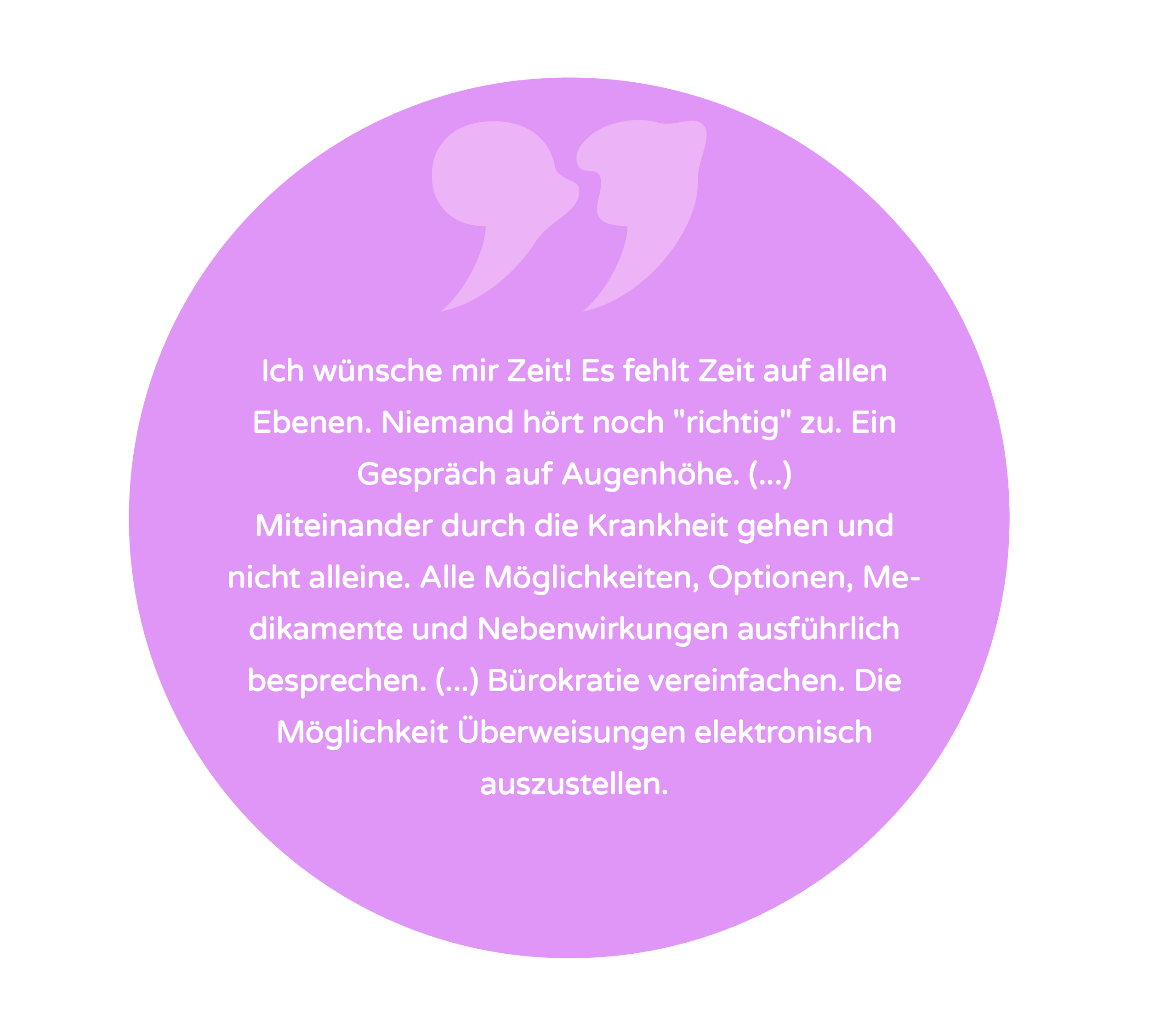

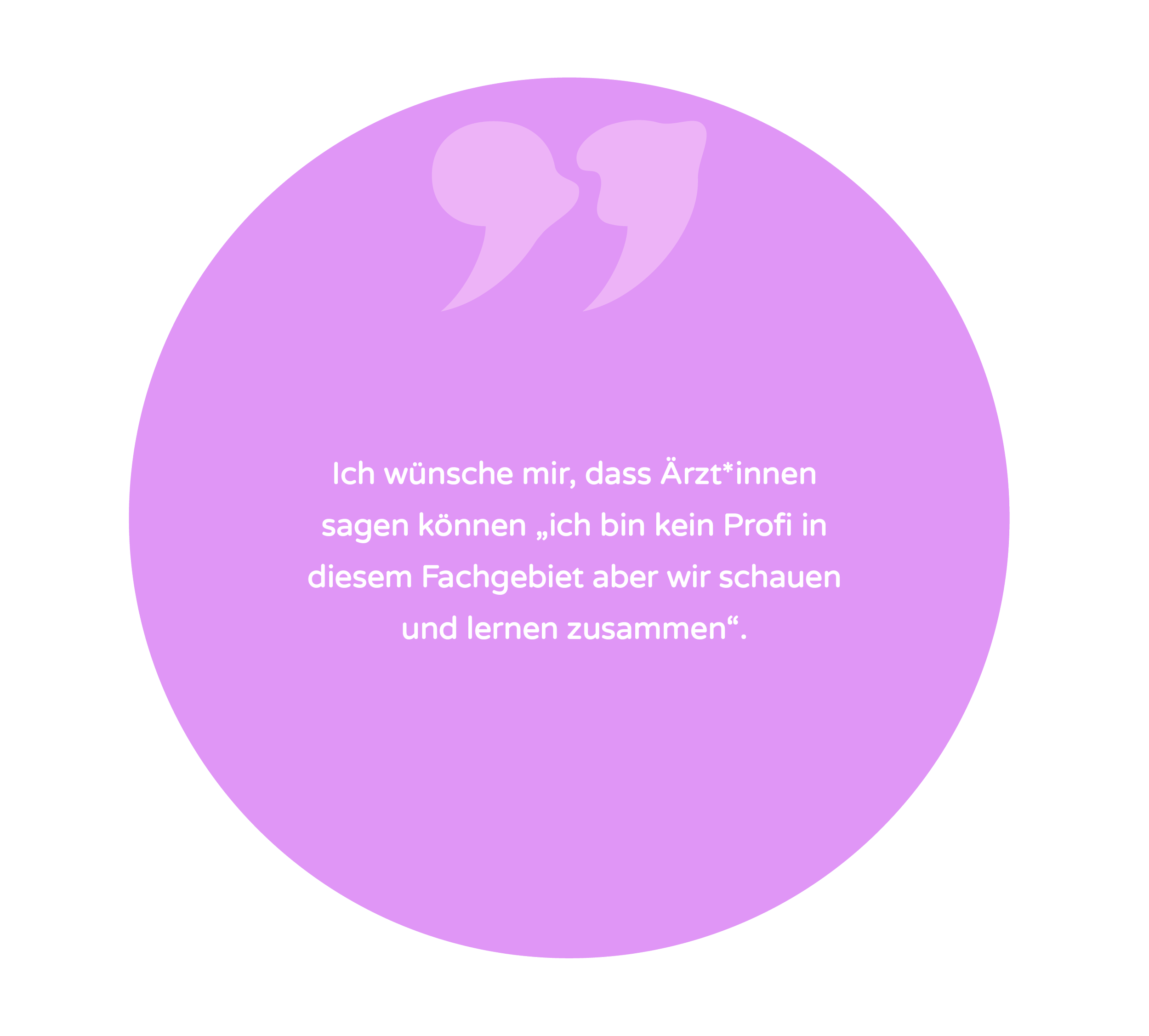
-
Praxisorientierter Leitfaden von Queermed
Hier (LINK)findet ihr wichtige Informationen zum Thema Diskriminierung und Handlungsempfehlungen für einen sensibilisieren Umgang mit Patient*innen.
Train-the-Trainer-Lehrgang zum geschlechtersensiblen Gesundheitssystem
Ein Programm zur Integration geschlechtersensibler Inhalte in die medizinische Ausbildung, das Lehrenden Methoden zur Vermittlung dieser Themen an die Hand gibt. Dort werden weitere Programme gelistet
Kontaktdaten:
https://agenda-gesundheitsfoerderung.at/kogug/Train-the-Trainer-Lehrgang
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
stellt ebenfalls Wissen zur Selbstreflexion sowie zum Austausch im Gesundheitswesen zur Verfügung:
https://infodienst.bioeg.de/gesundheitsfoerderung/fachinformationen/
Handreichung für die Integration geschlechtssensibler Medizin in die Lehre von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
erklärt die Bedeutung von geschlechtssensibler Medizin und erläutert Fachbegriffe.
-
(1) Ainsworth, Claire (2015): Sex redefined, in: Nature, 518(7539), 288–291, https://doi.org/10.1038/518288a.
(2) AMBOSS (2025): Bias, Stereotype und Diskriminierung in der Medizin, AMBOSS, [online] https://www.amboss.com/de/wissen/bias-stereotype-und-diskriminierung-in-der-medizin [Zugriff: 15.09.2025].
(3) Grzybek, Samson (2024). Leitfaden zum sensibilisierten Umgang mit Patient*innen, Queermed Deutschland, [online] https://queermed-deutschland.de/wp-content/uploads/2024/04/Queermed_Deutschland_Leitfaden_sensibilisierter_Umgang_mit_Patient_innen_V1_2024.pdf [Zugriff: 15.09.2025]
(4) Stiftung Gesundheitswissen (2020): Auf Augenhöhe mit dem Arzt, Stiftung Gesundheitswissen, [online] https://www.stiftung-gesundheitswissen.de/gesundes-leben/patient-arzt/patient-und-partner [Zugriff: 15.09.2025].


